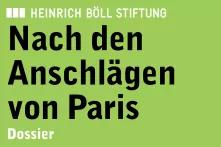Ein starker UN-Sicherheitsrat kann helfen die notwendigen Trennlinien zu ziehen zwischen inneren Gegnern im Bürgerkrieg und den Aggressoren des IS, die die Staatenordnung der UN generell negieren, sagt Joscha Schmierer.
Fast grenzt es an ein Wunder, dass es bisher erst zu einem tödlichen Zusammenstoß gekommen ist, dem Abschuss eines russischen Bombers durch türkische Jagdflieger, trotz so viel Luftwaffeneinsatz so vieler unterschiedlicher Interventionsmächte auf so engem Luftraum wie dem über Syrien und Nordirak. Es wird sich vielleicht nie klären lassen, ob hierbei der türkische Luftraum durch den russischen Bomber oder der syrische Luftraum durch die türkischen Jäger verletzt wurde. Wenigstens am Himmel gibt es keine Zäune. Das Mein und Dein ist nicht so eindeutig geschieden wie auf Erden. Die Entscheidungen fallen innerhalb von Sekunden. Am syrischen Himmel gibt es gegenwärtig viele Spieler/innen und keine Regeln, die von allen geteilt werden. Die Rechtsgründe, auf die sie sich jeweils berufen, sind mehr oder weniger selbstgestrickt. Und manchmal schließen sie sich gegenseitig aus. Es riecht nach Pulver.
Zusammenstoß von Staaten liegt in der Luft
Das Attentat von Sarajewo 1914 - es wurde immerhin zum Anlass des Ersten Weltkrieges - erscheint im Vergleich zu den Zusammenstößen, die sich über und vielleicht bald in Syrien ereignen können fast als vernachlässigbarer Zwischenfall. Bei dem Abschuss der russischen Maschine handelte es sich um einen Zusammenstoß von Staaten und nicht um einen Angriff einer terroristischen Gruppe auf eine politische Symbolfigur wie den habsburgischen Kronprinzen. Damals musste das Ereignis erst auf die zwischenstaatliche Ebene gehoben werden, bevor es zum Kriegsanlass taugte.
Hinter einem solchen Zusammenstoß zwischen Staaten lauert tatsächlich der „Weltkrieg“, den die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (15.11.2015) glaubte beschwören zu müssen, als sie über die Pariser Attentate zu reflektieren meinte. Doch erst die Verwicklung der großen Mächte in „kleine Kriege“ schafft diese Gefahr. Noch die blutigsten Bürgerkriege können regional vor sich hin köcheln, bevor man sich international für sie interessiert, weil ein Attentat in Paris grellen Widerschein findet oder mit dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges in dem Durcheinander äußerer Interventionen relevante Mächte auf einander stoßen. Freilich sind Staaten prinzipiell auch in der Lage, einen Konflikt zu begrenzen und sich verbindlich zu verständigen. Die Türkei und Russland werden sich schon allein wegen des gleichartigen Führungspersonals damit schwer tun.
Allianzen schaffen
Die Welt steht wieder einmal auf der Kippe. Die Frage ist, ob zunehmendes Durcheinander und gefährlich wachsende Spannungen in einen großen Krieg münden können oder ob es gelingt, gerade in diesem Durcheinander einen umfassenden Verständigungsprozess unter den konfligierenden Mächten in Gang zu bringen? In den syrischen Fall sind immerhin alle ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und all jene Regionalmächte verwickelt, die sich unter machtpolitischen Vorzeichen und mit kulturellen und religiösen Motiven nicht nur in Syrien während der letzten Jahre immer stärker in die Quere kommen.
Und da macht sich ausgerechnet der innenpolitisch arg gebeutelte französische Präsident daran, eine große Allianz gegen den angeblich gemeinsamen Hauptfeind, den „Islamischen Staat“ (IS), zu schmieden Jedenfalls hat er das zur Mission seiner weit gespreizten Reisediplomatie erklärt. In Russland musste er sich dabei ziemlich verrenken. Schließlich hat Frankreich so früh und so entschieden wie allenfalls noch die Türkei, den Sturz von Assad zur Vorbedingung jeder friedlichen Lösung im syrischen Bürgerkrieg erklärt, während Russland, wie stets, wenn es in seinen Kram passt, energisch auf der Anerkennung der völkerrechtlichen Legitimität des Assad-Regimes besteht. Jetzt scheint mindestens Frankreich sogar die syrische Armee als Bodentruppe einer solchen Allianz ins Auge zu fassen. Von den kurdischen Streitkräften war früher schon mal als „Bodentruppen des Westens“ (FAZ) gegen den IS die Rede.
Der kleinste Nenner wird nicht reichen
Damit es zu einer Verständigung aller relevanten Kräfte in Syrien und der verwickelten Regionalmächte kommt und sie ihre Differenzen zugunsten der Rückeroberung der vom IS besetzten Gebiete zurückstellen, ist der pure Anti-IS-Ansatz als vermuteter kleinster gemeinsamer Nenner nicht ausreichend. Manche Beteiligten halten ja den IS für ihre eigentliche Hilfstruppe, die zurzeit nur ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Erst recht für eine Einigung im Sicherheitsrat braucht es ein Konzept für die Rekonstruktion der syrischen und irakischen Staaten als Mitglieder der UN. Der intellektuell bequeme Ausweg aus dieser Schwierigkeit, eine wie immer geartete Zerstückelung dieser Staaten ins Auge zu fassen, läuft in Wirklichkeit auf Dauerkonflikte um Teilterritorien und ihre Grenzen hinaus, innerhalb der bestehenden Staaten und zwischen den entsprechenden Nachbarstaaten.
Eine Waffenstillstands- oder gar Friedensregelung ist jedenfalls heute sehr viel schwieriger als zu Beginn des Bürgerkrieges, als die Staatsgrenzen noch nicht in Frage standen. Damals hofften die einen auf einen Sturz des Assad-Regimes binnen Tagen und Wochen, während die anderen fürchteten, dass in diesem Fall ihre Interessen erheblich geschädigt würden und die syrische Regierung deshalb mächtig unterstützten.
Dass in Voraussicht auf die verheerenden Wirkungen eines Bürgerkriegs ein Waffenstillstand im Interesse Syriens und seiner Bevölkerung auch gegen die Bürgerkriegsparteien hätte erzwungen werden müssen, ist nicht erst nachträglich offensichtlich. Aber solange der Bürgerkrieg nur Syrien traf….
Ob eine friedenschaffende Allianz jetzt gelingt und den Sicherheitsrat als Ordnungsmacht handlungsfähig macht, ist auch nach Hollandes um vier Jahre verspätetem Auftritt als weltpolitischer Zampano fraglich. Vielleicht sind Hollandes Bemühungen bloß eine Flucht von seinen innenpolitischen Schwierigkeiten und einigen verdrängten Problemen Frankreichs. Aber sie sind ein erster vernünftiger Versuch, dem Blutbad ein Ende zu bereiten. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die Autorität des Sicherheitsrates wieder herzustellen.
Von wegen professionell!
So empörend die brutalen Attentate in Paris an diesem 13. November waren, so ratlos lassen einen die anschließenden Kommentare und Verlautbarungen zurück. Da war von hoher Professionalität der Attentäter mit sowohl bewunderndem als auch entschuldigendem Unterton die Rede. Als ob es großen Verstand und viel Erfahrung verlangte, unter überraschten und wehrlosen Menschen ein Massaker anzurichten. Die Attentate vor dem Stade de France kann man ohnehin als gescheitert ansehen, sollten die Sprengstoffgürtel doch im Stadioninneren gezündet werden. Die Wohnung, in der ein Teil der Attentäter nach vollbrachter Tat Unterschlupf fand, um vielleicht weitere Bluttaten vorzubereiten, wurde, wie zu lesen war, mit Hilfe eines an einem der Tatorte gefundenen Handys aufgespürt. Professionalität sieht anders aus, macht die Taten jedoch nicht weniger beunruhigend. Sie erinnern eher an einen Amoklauf als an eine von langer Hand durchgeplante Aktion militärisch geschulter Krieger. Als Amokläufe können sie sich jederzeit wiederholen und hierin durchaus an die USA erinnern. Aber ein Vergleich mit den von außen geführten Angriffen vom 11. September 2001 auf die USA ist abwegig.
Dennoch spielten in die Kommentare schon bei der Charakterisierung der Taten und Täter die Erinnerungen an den 11. September 2001 hinein. Allenfalls den Motiven der Täter nach sind die Attentate in Paris und die sorgsam abgestimmten, tatsächlich professionellen Anschläge auf das New Yorker World Trade Center vergleichbar. Vielleicht liegt darin ein Unterschied zwischen Al Qaida und dem IS. Die einen schafften einen in Umfang und Vernichtungskraft wahrscheinlich nicht wiederholbaren Anschlag auf die USA, die anderen üben über eine weitläufige territoriale Besatzung in den historischen Kerngebieten der früheren arabisch-islamischen Eroberungen eine wesentlich größere propagandistische Wirkung auf potentielle Terroristen rund um die Welt aus, eben auch in Europa, vielleicht vor allem in Frankreich und Belgien. Sie schicken Amateure und Dilettanten des Terrors ins Feld. Wie soll man sie also im Vorhinein aufspüren und bekriegen?
Mimetische Konkurrenz
Das wirkliche Déjà-vu waren nicht die Attentate, sondern die Reaktionen des französischen Präsidenten. Sofort interpretierte er die Anschläge als Kriegshandlung des IS in Frankreich, auf die wiederum nur Krieg in Syrien die angemessene Antwort sein könne. Offensichtlich hat George W. Bush mit seinen Redefiguren seinerzeit eine Art ikonographisches Leitbild für den Umgang mit unerhörten terroristischen Gräueltaten geschaffen. Es verlockt zur Nachahmung. Der machomäßige Auftritt von nationalen Führungsfiguren macht global Schule. Der kürzlich verstorbene französische Anthropologe René Girard sah in dieser mimetischen Konkurrenz eine Haupttriebkraft gewaltsamer Auseinandersetzung.
Man hätte erwarten können, dass ein besonnener Staatsführer feststellt: Auch wenn die Täter ihren Amoklauf als Kriegshandlung wahrnehmen und rechtfertigen, kann die Antwort der Republik darauf nur sein, sie wie Verbrecher zu behandeln, sie nach Möglichkeit vor Gericht zu stellen und in den Knast zu bringen. Stattdessen folgte Hollande in seiner Kriegsrhetorik George W. Bush in die rechtliche Grauzone, aus der die USA bis heute nicht herausgefunden haben. Ihre Unfähigkeit Guantanamo zu schließen und die verbliebenen Gefangenen entweder vor Gericht zu stellen oder frei zu lassen, steht für die Ausweglosigkeit eines „Krieges gegen den Terror“, der kein Ende finden kann und deshalb keine Kriegsgefangenen kennt, die bei Kriegsende entlassen werden. So muss ein Sonderstatus für die Gefangengen geschaffen werden: Ohne Prozess können sie im Prinzip lebenslänglich im Käfig gehalten bleiben.
Einen Unterschied machen
Es müsste bei den Attentaten in Paris leichter fallen als nach dem 11. September 2001 in den USA, zwischen den Verbrechen von Franzosen und anderen europäischen Einheimischen auf französischem Boden und den kriegerischen Eroberungszügen des IS zu unterscheiden, statt erneut den Krieg gegen den Terror ins Dunkle hinein auszurufen. Der IS hat in großen Teilen Syriens und des Irak seine Territorialherrschaft errichtet. Diese Herrschaft kann nur mit militärischen Mitteln gebrochen werden. Das ist im Prinzip eine Aufgabe des irakischen und syrischen Staates, aber die internationale Gemeinschaft hat auch eine Verpflichtung, UN-Mitglieder im Kampf gegen Angriffe auf ihre territoriale Integrität zu unterstützen. Man sollte den Kampf gegen die Terroristen im eigenen Land nicht mit dem Kampf gegen IS in Syrien und Irak in einen Topf werfen, auch wenn die islamistische Rhetorik einen weltweiten Krieg gegen Ungläubige verficht. Im einen Fall geht es um die Souveränität Frankreichs, im anderen Fall um die Souveränität Syriens und des Irak. Im einen Fall ist Frankreich gefordert, im anderen Fall ist es der Sicherheitsrat der UN, wenn die betroffenen Staaten nicht in der Lage sind, ihre Bevölkerung zu schützen. Im einen Fall verfügt die französische Republik über die Polizeigewalt, im anderen Fall maßt sie sich der IS in Syrien und im Irak gewaltsam an.
Die Bundesrepublik ist im Rahmen der EU zur Unterstützung Frankreichs im polizeilichen Kampf gegen terroristische Anschläge verpflichtet. Gegenüber Syrien und Irak muss sie sich innerhalb der UN solidarisch verhalten und sich für die notwendigen, auch militärischen Maßnahmen zum Schutz von deren territorialen Integrität und Souveränität einsetzen. Das kann die Beteiligung an einem Krieg gegen die Territorialherrschaft des IS in Syrien und Irak bedeuten. Das wäre aber keine Teilnahme an einem ort- und regellosen globalen „Krieg gegen den Terror“.
Die Zerschlagung der Territorialherrschaft des IS innerhalb Syriens und des Irak wird freilich weder den Mythos einer Wiedererrichtung des Kalifats zerstören, noch wird es den Kampf gegen den Terrorismus beenden. Der IS wird zerschlagen sein und seine Träger/innen werden in alle Himmelsrichtungen das Weite suchen. Und überall am Mythos des Kalifats arbeiten. Der Krieg wäre vorbei, aber nicht der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Er hat bereits in zu vielen Staaten Fuß gefasst. Man soll sich keine Illusionen machen.
Historische Sensibilität ist nötig
Schon vor den Attentaten vom 13. November führte Frankreich einen Bombenkrieg gegen den IS in Syrien. Die Attentate können damit als kriegerische Antwort darauf und umgekehrt als weitere Rechtfertigung für diese völkerrechtlich umstrittenen Angriffe, ihre Intensivierung und die Ausrufung des Ausnahmezustandes im Inneren dienen, so als müsse die Nation sich nach der Eröffnung der äußeren Kriegshandlungen auch für den Bürgerkrieg im Inneren rüsten. Besonders problematisch ist ein solcher Schattenkrieg in der Grauzone in einem Land, dessen Bürgerinnen und Bürger nordafrikanischer Herkunft sich wahrscheinlich noch gut an einen entsprechenden Ausnahmezustand erinnern.
Bis heute wissen die Historiker nur ungefähr, wie viele „algerische Arbeiter“ und „muslimische Franzosen“ bei den Protestmärschen gegen die über sie verhängte nächtliche Ausgangssperre am 17. Oktober 1961 erschossen oder in die Seine geworfen wurden. Mehr als 200 Tote waren es nach niedrigster Schätzung, darunter viele Frauen und Kinder, von den Toten im Algerienkrieg selbst ganz zu schweigen. Ich denke in den Banlieues von Paris sind diese Erfahrungen als Familiengeschichten lebendig. Das „couvre-feu“ , die Ausgangssperre, wurde mit rassistischer Gesichts- und selektiver Ausweiskontrolle durchgesetzt.
Als Jugendlicher war ich Augenzeuge des Zusammenstoßes auf der Brücke zwischen Boulevard Saint Michel und der Cité mit Sitz des Polizeipräsidiums. Einen derart entfesselten Polizeisturm wie den der kasernierten Bereitschaftspolizei CRS auf die unbewaffneten und auf der Brücke eingezwängten Demonstranten habe ich später nie mehr erlebt. Chef der Pariser Polizei war damals Maurice Papon, der erst 1998 vor Gericht gestellt wurde wegen seiner Kollaboration mit der deutschen Besatzung bei der Deportation von mehr als 1500 Juden, die er als Verantwortlicher des Vichy-Regimes angeordnet hatte.
Auch deshalb können manche der mimetischen kriegerischen Gesten Hollandes à la George W. Bush verletzen, allein durch die Geschichtsvergessenheit, die sie offenlegen.
Sich patriotisch zu berauschen ist gefährlich
Michel Wieviorka, Forschungsdirektor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) und Autor von auch ins Deutsche übersetzten soziologischen Studien zur Gewalt, meinte zu der „Kriegserklärung“ Hollandes in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 19. November:
„Viele vergleichen Hollande schon lange mit Guy Mollet, dem sozialistischen Ministerpräsidenten zu Beginn des Algerienkrieges, der links redete, aber eine harte rechte Politik durchpeitschte. Hollande handelt schon lange wie ein Rechter und redet wie ein Feldherr. Es ist klar, dass mit dem vergangenen Freitag ein neues Kapitel der französischen Geschichte beginnt.“ Nach Wieviorka wird es ein dunkles Kapitel. Den rhetorischen Wettstreit gegen den Front National könne Hollande nur verlieren, Marine Le Pen werde immer noch schärfer formulieren als er. „Die politische Situation wird sich total verdüstern, der rassistisch-xenophobe Diskurs ist schon jetzt kaum zu ertragen. Und die Muslime sind schon jetzt in einer unerträglichen Situation. Genau wie die Juden, aber aus völlig anderen Gründen.“
Der verlängerte Ausnahmezustand könnte zum Deckel auf einem Topf werden, der bereits am Überkochen ist. Und das hängt sicher mit der kaum aufgearbeiteten Geschichte des Algerienkrieges zusammen. In diesem Krieg waren innere und äußere Front eng mit einander verwoben, Polizei- und Militäraktionen kaum zu trennen, denn Algerien galt bekanntlich als französisches Departement und arabische Algerier bildeten die Mehrzahl der Migranten in Frankreich. Teilweise kämpften arabische Algerier auch auf der Seite der Kolonialmacht, während sich Franzosen in Algerien als die eigentlichen Algerier verstanden. Das alles machte den algerischen Unabhängigkeitskrieg so langwierig und verfestigte bei Franzosen die Ansicht, dass von algerischer Seite aus alles Terrorismus gewesen sei. Auch die Folterung von Verdächtigen wurde erst sehr spät als Verbrechen thematisiert und strafrechtlich nie konsequent verfolgt. Eigentlich hätten französische Politiker gute Gründe mit den Begriffen von Krieg und Terror vorsichtig umzugehen und terroristische Akte im Inneren nicht einfach mit äußerem Krieg zu vermengen und diesen dann in Syrien mit Bomben zu führen. Frankreich hat kein schlichtes muslimisches Migrationsproblem, sondern leidet an inneren Nachwehen eigener Kriege, vor allem des Algerienkrieges. Er ist kaum fünfzig Jahre vorbei.
Kein mare nostrum
Rund um das ehemals römische, aber niemals europäische mare nostrum, das heute gemeinsame Binnenmeer von Südeuropa, Nordafrika, der Levante und der Türkei, käme es darauf an, nach und nach ein angemessenes Bewusstsein von Nachbarschaft, das heißt von Nähe und Distanz, also auch von Grenzen zu entwickeln. Vor allem auch von Grenzen der Intervention in des Nachbarn Angelegenheiten.
Nun sind freilich schon so viele äußere Kräfte an den bewaffneten Auseinandersetzungen in Syrien und dem Irak beteiligt, dass es in der nächsten Zeit ganz darauf ankommen muss, den UN-Rahmen und die Rolle des Sicherheitsrates wieder zur Geltung zu bringen. Dafür bilden die jüngsten Verhandlungen in Wien einen gemeinsamen Eröffnungszug aller äußeren Beteiligten. Stellt man die Wiederherstellung des UN-Rahmens ins Zentrum, lässt sich auch eine klare Trennlinie zwischen den inneren Gegnern im Bürgerkrieg und den Aggressoren des IS ziehen, die ihre Kriegshandlungen nicht nur gegen die UN-Mitgliedsstaaten Syrien und Irak richten, um sie zu zerschlagen, sondern die Staatenordnung der UN generell negieren. Dieser Generalangriff auf die UN-Ordnung bildet letztlich die Legitimation von äußerer Intervention. Die vielen und willkürlichen Interventionen einzelner Staaten und einseitiger Allianzen müssen in eine vom Sicherheitsrat mandatierte gemeinsame Aktion überführt und durch sie abgelöst werden. Insofern hat man es zwar nicht mit einem Weltkrieg, aber doch mit einer Auseinandersetzung von weltweiter Bedeutung zu tun.